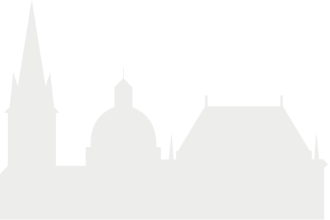Ansprache von Christoph Simonsen zum 16. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr C
Evangelium: Lukas 10,38-42
Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine Frau namens Marta nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen! Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.
Ansprache
Die gerade gehörte Begebenheit hätte auch ganz anders verlaufen können: Jesus klingelt an der Haustür. Martha öffnet. „Hey, schön, dass du da bist. Komm rein. Bist aber was früh, ich bin noch nicht fertig in der Küche.“ Setz dich doch noch einen Moment ins Wohnzimmer. Jesus nimmt also im Wohnzimmer Platz und Maria gesellt sich zu ihm. Die beiden unterhalten sich angeregt. Da kommt Maria plötzlich ein Blitzgedanke und sie fragt so laut vor sich hin, was Martha wohl gerade mache. Jesus überlegt auch einen Augenblick und schlägt dann vor: „Lass uns malnachschauen.“ Da steht Martha also in der Küche und die Anrichte ist ein einziges Chaos. Kurzentschlossen ziehen sich Maria und Jesus die Schürzen über: Jesus schält die Kartoffeln, Maria putzt den Salat. Martha macht eine Flasche Wein auf und sie bereiten gemeinsam das Essen, währenddessen sie sich angeregt unterhalten. Und wie von selbst ist das Dreiergespräch in Gang. Jesus erzählt von seinen Begegnungen der letzten Tage und die Schwestern von ihrem letzten ziemlich überflüssigen Schwesternknatsch.
So hätte es laufen können; und dieser ganze grundsätzliche Diskurs darüber, was wichtiger ist: beredtes Schaffen oder besinnliches Beisammensein wäre überflüssig wie ein Kropf am Hals. Aber so ist es leider nicht festgehalten in der Heiligen Schrift.
Was also ist da schief gelaufen in der Begegnung zwischen Martha und Jesus? Die drei hatten wohl völlig unterschiedliche Vorstellung darüber, wie der Besuch verlaufen sollte. Martha wollte alle ihre Künste aufwenden, um ihre Wertschätzung gegenüber Jesus deutlich zu machen; deshalb brutzelte sie in der Küche, um ein einmaliges Abendessen zu kreieren. Jesus aber hat sich offensichtlich den Abend aber ganz anders vorgestellt. Was wollte er? Ihm lag wohl weniger an einem guten Dinner als an einer lebendigen Begegnung. Jesus suchte das Gespräch, freute sich auf einander geschenkte Zeit; Jesus wollte einfach nur einen entspannten Abend gemeinsam mit Martha und Maria verbringen. Ich glaube, so war es.
Es geht in der Erzählung der beiden unterschiedlichen Schwestern um mehr als nur eine private Unstimmigkeit oder um ein mehr oder weniger nachhaltiges Missverständnis zwischen ihnen und Jesus. Es geht um eine Grundhaltung, die jeder menschlichen Begegnung zugrunde liegen sollte. Um eine Achtsamkeit darauf, was dem anderen gut tut. Wie oft setzen wir wie selbstverständlich voraus zu wissen, was dem anderen gut tut. Und dabei gehen wir nicht selten von unseren Bedürfnissen und Vorstellungen aus und versetzen uns viel zu wenig in die Situation unseres Gegenübers hinein. Martha meinte zu wissen, was Jesus gut tut, dabei hat sie Jesus völlig aus dem Blick verloren. Die Frage, die wir uns viel zu selten stellen, ist so banal, dass ich sie kaum wage auszusprechen: „Was kann ich tun, damit es dir gut geht?“.
Diese Frage trifft uns in einer gesellschaftlichen Situation, die offensichtlich geprägt ist von vielerlei Abgrenzungstendenzen und ausgrenzenden Ideologien; sie trifft uns in einer kirchlichen Situation, in der ganz viel Verunsicherung vorherrscht angesichts der Tatsache, dass viele Menschen in den Kirchen keine Heimat mehr finden. Diese Erzählung trifft jede und jeden von uns in einer ganz eigenen, vielleicht sogar nach außen hin gar nicht sichtbaren lebensgeschichtlichen Situation. Diese Erzählung trifft auf uns als Individuen, ebenso wie als politische und als mit Gott verbundene Menschen. Diese eine Frage muss in die konkreten Situationen unseres Lebens hineinbuchstabiert werden:
Was kann ich tun?“ Diese Frage hat etwas sehr entlastendes, aber auch etwas sehr herausforderndes an sich. Zum einen entlastet sie mich, immer schon wissen zu müssen, was zu tun ist. Zum anderen fordert sie mich, weil ich mich damit offen zeige, mich dem anderen zu stellen. Ich zeige mich lernbereit; ich zeige mich neugierig. Neugierig nicht auf irgendetwas, neugierig auf einen Menschen. Neugierig, die Oberfläche zu durchstoßen und zum Wesen, zum Wesentlichen vorzudringen.
„Was kann ich tun, damit es dir gut geht? Mit dieser Frage ist eine nicht unwichtige Konsequenz verbunden. Die nämlich, dass mein Wunsch um das Wohlsein des/der anderen automatisch mich selbst auch entspannter, zufriedener, glücklicher stimmt.
Der Abend ist noch lange und es ist Sommer. Man könnte sich doch nach dem Gottesdienst zuhause noch mal zusammensetzen, im Wohnzimmer oder im Garten, eine Flasche Wein aufmachen und miteinander den Abend genießen. Das wäre auch eine Art von Gottesdien