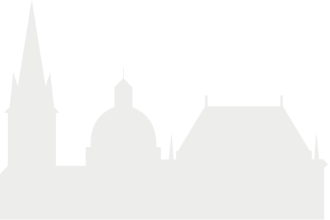Ansprache von Christoph Simonsen zum 28. Sonntag im Jahreskreis C
28. Sonntag im Jahreskreis C - 2019
Evangelium Lk 17,11-19
Es geschah auf dem Weg nach Jerusalem: Jesus zog durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns! Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern! Und es geschah: Während sie hingingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaríter. Da sagte Jesus: Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! Dein Glaube hat dich gerettet.
Ansprache:
Es gibt Begebenheiten, die sind lange aus dem Gedächtnis verschwunden; aber dann sieht man etwas oder liest etwas und sofort ist die Erinnerung wieder da. Als ich das heutige Evangelium zur Vorbereitung auf unseren Gottesdienst gelesen und meditiert habe, da erinnerte ich mich eines Besuches in Rom. Es war am 22. September 2013 und es goss in Strömen, als ich mich auf den Weg zum Petersplatz machte, um das Angelus Gebet mitzubeten. Trotz der Enge und trotz des herunter prasselnden Regens spürte ich eine konzentrierte Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf dem Platz.
Ich hielt es kaum für möglich: So viele Menschen, die einander fremd sind und zugleich alle etwas gemeinsam haben: den Glauben. Glaube verbindet: das war die wichtige Erkenntnis, die ich an diesem Mittag gewinnen durfte. Glaube verbindet, auch wenn man sich fremd ist.
Dann, am Ende, nachdem einige bevorzugte Gruppen gesondert begrüßt wurden, löste sich die Menge auf. In Windeseile verkrochen sich die Menschen in die Seitenstraßen und Gassen der Via Conziliacone und bestürmten die Bars und Trattorias. Plötzlich war sich wieder jeder selbst der Nächste; nur irgendwie ganz schnell rein ins Trockene. Wer könnte das nicht verstehen. Die Kellner standen an den Eingängen und lockten zusätzlich mit besonders preiswerten wie schmackhaften Menüs. Auch ich wurde angesprochen und endlich war da auch eine kleine Bar, in der noch Platz war. Aber mit einem vehementen "no" und einer abweisenden Geste wurde mir der Zugang von diesem gleichen Kellner . "no bello" Zu deutsch: "Wir müssen draußen bleiben". Und mit "wir" war in dem Fall ich und meine beiden Hunde gemeint. Ich kann das Gefühl, das in diesem Moment in mir hochkam, nur ganz schwer beschreiben. Gerade noch eingebunden in einer unüberschaubar großen Menge von Menschen, die in aller Fremdheit zueinander gemeinsam gebetet und gesungen haben, wuchs in mir jetzt das Empfinden, ein Ausgeschlossener zu sein.
Ich weiß natürlich, dass es völlig unangemessen ist, sich jetzt so unvermittelt mit dem Leprakranken zu vergleichen, dessen Leid und das Gefühl von Verlassen-sein unvergleichlich größer gewesen ist. Aber, dieser Gedankenblitz war es, der mich in Gedanken nach Rom zurückgeführt hat, dieses Gefühl, unverstanden zu sein, ungerecht behandelt zu werden, im wahrsten Sinn des Wortes "im Regen stehen gelassen" zu werden.
Religion, Glaube, Menschlichkeit, spielt sich das alles nur noch in abgezirkelten Räumen ab, jenseits allen weltlichen Geschehens? Ist die Lebenswirklichkeit des Aussätzigen die Normalität: Rein kommen die, die von den Kellnern bzw. von den Priestern für rein erklärt werden und alle anderen müssen draußen bleiben? Und ist es tatsächlich so, dass die Kellner, bzw. die Priester die Hoheit darüber besitzen, zu bekunden, wer und was rein bzw. unrein ist?
Darüber wird auch in unserer Kirche gerade heftig diskutiert. Seien es die Menschen, die zum zweiten Mal geheiratet haben und in ihrem Neuanfang gewürdigt werden möchten; seien es die Frauen, die in diesen Tagen unüberhörbar auf sich aufmerksam machen.
In diesem Augenblick, wo ich da draußen auf der Straße irgendwo in Rom stand, völlig durchnässt und innerlich zerrieben zwischen Verlorenheit und Wut, da hab ich für einen Augenblick essentiell erfahren, was es heißt, verstoßen zu sein. Zugleich hab ich aber auch erkannt, wie wichtig es ist, bei sich zu sein und sich selbst treu zu bleiben. Für nichts in der Welt hätte ich um Einlass gebettelt. Das mag man jetzt Stolz nennen, für mich war es ein Akt der Selbstachtung.
Mir wurde in diesen Minuten bewusst, wie wertvoll es sein kann, sich in die Rolle eines oder einer anderen hineinzuversetzen. Der oder die am Rande, der Ausgestoßene, der Fremde, das sind nicht immer nur die anderen. In der Identifikation mit ihnen wurde mir meine eigene Menschlichkeit und Abhängigkeit wieder bewusster.
Aber was nutzt die geradlinigste Selbstachtung, wenn man dann doch auf der Straße steht, nass, verkühlt und - schlimmer - isoliert und kontaktlos? Da erkenne ich bei dem Aussätzigen eine Tugend, die zu leben mir nicht in den Sinn gekommen ist. Selbstachtung alleine genügt nicht für ein Leben in Gemeinschaft; es bedarf auch der Tugend der Selbstüberwindung. Der Mann aus Samarien war nicht nur ausgestoßen, er war auch ein Fremder in der Welt Galiläas. Er war ein Ausgestoßener in der Fremde. Und als Fremder geht er auf einen Fremden zu: auf Jesus. Und in dieser Begegnung geschieht Ungeheuerliches: Ein Fremder traut einem Fremden und zeigt eine große Vertrautheit. Jesus ist gerührt von dieser Geste und erwidert ihm: „Dein Glaube hat dir geholfen“. Jesus traut dem Glauben des Fremden. Er sagt ja eben nicht „mein Glaube wird dir helfen, der Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Glaube der Väter an den Schöpfergott Jahwe; all das sagt er nicht. Er sagt: „Dein Glaube hat dir geholfen“. Jesus vertraut dem Glauben des Fremden aus Samaria. Interessant finde ich an dieser Stelle, dass über den Glauben des Ausgestoßenen gar nichts gesagt wird. Sein Glaube bleibt uns verborgen.
Allein, dass er glaubt ist wichtig, und dass sein Glaube Dankbarkeit und Vertrauen nach sich zieht. Dieses Wechselspiel von Vertrauen und Dankbarkeit ermöglicht Menschlichkeit über alle Unterschiede hinweg.
Diese Ermutigung Jesu, dem Glauben des anderen zu vertrauen ist eine Ermutigung für uns heute im interkonfessionellen und interreligiösen Dialog. Es ist eine Ermutigung, es ist aber auch eine Verpflichtung. Für mich – für uns alle vielleicht – ist dies die größte Herausforderung auf dem Weg eines friedlichen Miteinanders, dem Fremden und der Fremdheit zu vertrauen und diesem Vertrauen eine größere Macht zuzubilligen als der Angst. Die Ereignisse in Halle, die uns alle so sehr bedrücken, sind der beste Beweis dafür. Fremdheit überwinde ich, indem ich mich dem Fremden stelle und das Fremde in mir selbst wahrnehme. In dem Fremden, ja manchmal sogar in dem Befremdlichen in mir, da offenbart sich die Kraft, die mich neu leben lässt und die mich mit den anderen verbindet. Die guten Kräfte im anderen entdecken, sie beim Namen nennen und ermutigen, sie auch zu leben: „Dein Glaube hat dir geholfen“. Wenn unsere Empfindsamkeit andere ermutigt, ihrem Glauben zugewandt leben zu können, dann werden auch wir getragen sein von einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit.
Christoph Simonsen