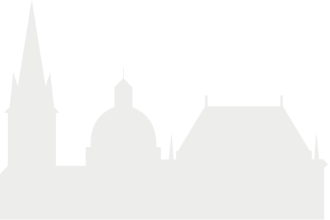Ansprache von Christoph Simonsen zum 4. Fastensonntag
Evangelium Joh 9, 1.6-9.13-17.34-38
In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Schiloach heißt übersetzt: Der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen; dann wusch ich mich, und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder.
Ansprache
Liebe Leserinnen und Leser unserer Homepage, das Evangelium des heutigen Sonntags kommt sozusagen wie gerufen, stellt es doch die Fragen, die uns heute bewegen, wo nichts ist, wie wir es gewohnt sind:
Ist man dann ein guter Mensch, wenn man das Schicksal, das einem auferlegt ist, demütig annimmt? Ist jede und jeder von uns angehalten, sich in die Rolle, die einem das Leben auferlegt hat, einzufügen? Sind Gebote dazu da, sie ungefragt einzuhalten?
Für den Blinden und den Gelähmten soll dies alles so gelten; das meinen zumindest die Außenstehenden, die Gesunden. Der Blinde soll am Stadttor verharren und dankbar sein für die Almosen, die ihm entgegen geworfen werden. Und wenn Jesus das anders sieht, dann durchkreuzt er in doppelter Hinsicht das göttliche Gebot: er widersetzt sich der Behauptung, dass Schicksal Gott gewollt ist und er widersetzt sich dem strengen Gebot der Sabbatruhe, das seine Glaubensgefährtinnen und Gefährten so hochhalten.
Wir sind doch immer wieder versucht, unser Leben planbar machen zu wollen und hängen der Überzeugung nach, dass das Leben um so sicherer ist, je strukturierter wir es sortieren. Ein Leben, das unseren Regeln nicht folgt, ist uns suspekt. Wann würden wir das besser spüren als in diesen Tagen, in denen ein Virus alles außer Kraft setzt, woran wir gewohnt sind.
Dem Blinden im heutigenn Evangelium ist all das sehr vertraut: Ihm werden die Regeln, nach denen er zu leben hat, von Außenstehenden diktiert; er wird dahin geschupst, wo die anderen ihn haben wollen: nach draußen vor die Tür nämlich. So wie wir gerade von den äußeren Umständen genötigt werden, uns im Inneren unserer Häuser aufzuhalten, so wird der Blinde eben vor die Tür gesetzt. Was für uns eine zeitbegrenzte Einengung unserer Lebensfreiheiten ist, ist für den Blinden die Normaität. Der Blinde wird in seine Rolle verwiesen, aus der er nicht entfliehen darf, weil er sonst nämlich das System von Gut und Böse in Frage stellt. Denn Schicksal ist nicht Schicksal sondern gottgewollt, und wer diesem Urteil widerspricht, der lästert Gott. So behaupten ja heute sogar unbelehrbare Glaubensfanatiker, dass Covid19 ein Gotteszeichen sei, uns freiheitsliebende Menschen wieder auf den Pfad der Tugend zu bringen.
Damals wie heute wollen tatsächlich Menschen: Die anderen sind die Sünder und wir sind die Gotteskinder. Gut: damals war es die Mehrheit der Juden, die davon überzeugt waren, heute sind es ein paar ewig Gestrige, die sich in dieser Weise auf Gott berufen. Aber macht es das besser? Das ist doch eine tolle Sache, wenn man mit voller Inbrunst seine eigene Reinheit stolz auf der Brust tragen kann und den anderen die Flecken des Makels aufs Hemd spritzen kann. Und bei all dem beruft man sich doch noch auf Gott selbst.
In solch einem System kann kein Glaube aufblühen. In solch einem Lebensmuster macht sich der Mensch zum Maßstab des Seins und Gott ist nicht mehr als der kleine Gehilfe des Menschen, dessen Daseinsberechtigung darin besteht, den selbstgerechten Menschen in Sicherheit zu wiegen. Nein, in solch einem System kann kein Glaube aufblühen, weil jede und jeder nur bei sich bleibt und weil nur ein Interesse das Leben bestimmt, nämlich: glatt und reibungslos durch eben dieses Leben zu manövrieren. Wenn jede und jeder bei sich bleibt, bleibt Gott auf der Strecke und wir Menschen verlieren unsere Menschlichkeit.
Das Evangelium zeichnet da klar und unmissverständlich ein Gegenmodell auf. Jesus nimmt den Blinden wahr, er spricht ihn an, er macht sich - im wahrsten Sinn des Wortes - die Hände schmutzig für ihn, und zu allererst: er sorgt sich um ihn. Fürsorge, damals wie heute das Stichwort, das Leben schenkt.
Und der Blinde? Er will seiner Mühsal entfliehen, für ihn ist sein Gebrechen nicht gottgewollt sondern eine Lebenstragik. Er erwartet mehr vom Leben als das, was ihm aus eigenem Antrieb heraus möglich ist. Und er erwartet mehr als das, was die gläubige Gesellschaft ihm zubilligt. Er sucht eine heilsame Veränderung; er sucht einen Weg aus der gegebenen Begrenztheit heraus. Er glaubt, dass Gott etwas mit ihm vorhat, dass er – wenn auch nicht aus eigenem Vermögen, sondern aus der Kraft des Glaubens – über sich hinauswachsen kann. Er glaubt, dass noch etwas aussteht in seinem Leben, dass er mehr erwarten darf. Und in dieser Erwartung erweist sich die Begegnung mit Jesus als wunderbar und heilsam. Diesen Glauben des Blinden wünsche ich uns, dass wir über uns hinauswachsen und neue Möglichkeiten der Begegnung ergründen. In solch unverhofften Begegnungen geschieht Unverhofftes und auf dem Höhepunkt solcher Art Begegnungen wird aus einem Gespräch ein Bekenntnis: „Ich glaube, Herr!“.
Gebet:
Gott, unser Leben ist ständig in Bewegung. Lass uns wieder aufblicken und die Augen offen halten für das, was wirklich wertvoll ist und dem Leben dient. So können wir ändern, was verändert werden muss und wir werden sensibel für Momente, wo Menschen isoliert werden. Begleite und stärke uns bei unserem Wunsch, das Leben in Bewegung zu halten. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen!
Christoph Simonsen
Leiter der Citypastoral Mönchengladbach, Kirchplatz 14, 41061 Mönchengladbach