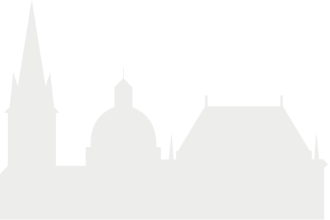Ansprache von Christoph Simonsen zum 4. Sonntag der Osterzeit - Lesejahr B
Evangelium nach Johannes (Joh 10,11-18)
Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht; und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören; dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
Ansprache:
Wir hören heute, 3 Wochen nachdem wir das geheimnisvollste Fest des Lebens gefeiert haben, Worte Jesu, die er zu seinen Lebzeiten seinen Freund*innen zugesprochen hat. Es sind Worte und Überzeugungen, die bekunden: der Wegbegleiter der Jünger*innen vor Ostern und der unverhofft erscheinende Freund nach Ostern hat die größte Grenze des Lebens berührt, hat den Tod durschritten, aber er hat die gleichen Überzeugungen und Herzensanliegen wie zuvor: „Lass alle eins sein, damit die Welt glaube.“ Dieser Wunsch, dem Johannesevangelium entnommen, fasst in großer Klarheit zusammen, was wir auch heute in der Parabel vom Hirten und seiner Herde hören dürfen.
Diesem Anliegen Jesu, dass wir Menschen, ja die ganze Schöpfung einander verbunden wissen dürften, dass wir alle aus einem Stall stammen (um im Bild Jesu zu bleiben), dass wir einander nicht fürchten müssten, weil wir alle das gleiche zuhause haben, diesem Anliegen Jesu steht unsere Wirklichkeit leider Gottes viel zu oft diametral entgegen. Wir sehen überall Unterschiedenheiten: zwischen Katholiken, Protestanten oder Orthodoxen, ja sogar zwischen moderaten und traditionellen Christ*innen, zwischen Christen, Juden und Muslimen, zwischen Europäern und Afrikanern, zwischen Hetereo- Homo Bi- und Transsexuellen; die Liste der Unterschiedenheiten ließe sich noch unendlich erweitern. Und es stimmt ja auch, diese Unterschiedenheiten gibt es. Die Frage, die uns das heutige Evangelium stellt, ist allerdings: Wie wir diese Unterschiedenheiten beurteilen, wie wir mit ihnen umgehen.
In einem sind wir uns – so wünsche ich es mir – gemeinsam einig: Wir ersehnen eine Welt, in der die Menschen wirklich eins sind, in der Menschen achtsam und friedvoll einander begegnen. Dieser Sehnsucht, diesem Wunsch steht dann aber leider Gottes eine menschliche Eigenschaft diametral gegenüber, die zunichtemachen muss, was wir eigentlich ersehen und erhoffen. Die Überzeugung nämlich, dass die anderen sich uns anpassen müssen; die Überzeugung, wir wären der Maßstab und die anderen müssten sich angleichen. Und das wiederum sagt dann jede Gruppe von sich, so dass der eine Stall Gottes – um wieder im Bild des heutigen Evangeliums zu bleiben – von den Bewohner*innen unterteilt wird und überall Trennwände aufgebaut werden. Und jede und jeder sagt dann: Wenn Du Dich mir anpasst, dann können wir den Zaun zwischen uns einreißen.
Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen: Der Wunsch Jesu nach Einheit und einem friedlichen Zusammenleben in einem Stall, in einer Welt, wird so nie und nimmer Wirklichkeit werden; er zerschellt an der Überheblichkeit der Menschen, die andere bewerten nach ihren Maßstäben.
Jegliche „Trennung ist gegen den Willen Christi. Sie ist ein Skandal. Die Einheit der Christen ist der Wille Jesu Christi. Es gibt keine Alternative, als uns um die Einheit zu bemühen.“ Dieser Gedanke von Kardinal Kasper, den er einmal in einem Vortrag, den er in Trier gehalten hat, zur Diskussion gestellt hat, ist allerdings – wenn wir Jesus wirklich ernst nehmen - noch zu kurz gegriffen, denn er spricht ja auch von den Schafen, die „nicht aus diesem Stall sind“. Jesus will auch die eingebunden wissen in der einen göttlichen Einheit, die nicht zum Kreis seiner Jünger*innen gehören.
Dieser Wunsch Jesu nach echter Verbundenheit ist die vielleicht größte menschliche Überforderung, an der wir Menschen erfahren müssen, wie unvollkommen wir doch sind und bleiben. Das unscheinbare Verb „bemühen“, das Kardinal Kasper wählt in seinem Gedanken, bewahrt einzig diesem Gedanken seine Glaubwürdigkeit. Aber ist, sich zu bemühen, nicht zu wenig?
Das ist die Schizophrenie unseres Lebens: Dass wir alle die Einheit ersehnen und zugleich an ihrer Verwirklichung immer wieder scheitern. Wie gehen wir damit um?
Zerbrechen wir daran, reiben wir uns auf an dieser Erkenntnis, den eigenen Idealen hechelnd hinterherzulaufen, verlieren wir den Mut, unseren eigenen Lebensvorstellungen zu vertrauen, werfen wir unsere Träume über Bord zugunsten eines nackten Realitätsinns?
Wir sollten auch nicht vergessen, dass nicht wenige Druck, Zwang, ja sogar: Gewalt anwenden aus der vermeintlichen Überzeugung heraus, sie stünden in der wahrhaft einzig richtigen Verbundenheit mit Gott und die anderen wären verloren, verdammt, wenn sie auf ihren Wegen weitergehen würden. Solche Überheblichkeiten zeigen sich nicht nur zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften; sie sind auch spürbar unter uns Christ*innen. Und auch nicht vergessen sollten wir, dass es Menschen gibt, die einen Bezug zum wirklichen Leben verlieren, sich in Scheinwelten verschließen, und glauben, in den Utopien ihres Daseins würden sie eine tragende Verbundenheit, die Einheit mit Gott und der Welt finden.
All diese Wege ist Jesus nicht gegangen: Weder ist er an der Wirklichkeit des realen Lebens verzweifelt, obgleich er allen Grund dazu gehabt hätte, noch ist er gewalttätig geworden – und Gewalt zeigt sich nicht nur in geballten Fäusten, sondern auch in andere ausgrenzenden Worten -, noch hat er sich in Scheinwelten geflüchtet. Jesus lebte und lebt seine Sehnsucht nach Einheit anders. Er lebte und er lebt sie anders, weil er sich geliebt wusste und geliebt weiß. Bei allem, was ihm widerfahren ist, wusste er sich geliebt. Und in dieser Gewissheit der Liebe vermochte er, diese unendliche Spanne zwischen Wirklichkeit und Sehnsucht auszuhalten.
Wer sich geliebt weiß, der kann seine Träume leben, selbst wenn sie unerreichbar scheinen. Verbundenheit, erfahrene Zugehörigkeit ist eine Frage des „Sich-Geliebt-Wissens. Wer sich geliebt weiß, der muss seine menschlichen Kräfte nicht mehr darauf verwenden, Verbundenheit zu erringen, der weiß sich verbunden und der vermag Verbundenheit zu erspüren, selbst wenn Verschiedenheit da ist.
Ein kleines Symbol dafür ist das Licht aus Altenberg. Seit Kriegsende 1945 wird es jedes Jahr entzündet und weitergeschenkt als Zeichen der Verbundenheit und der Versöhnungsbereitschaft; es ist entstanden aus der Erfahrung, dass Menschen verschiedener Kulturen und Traditionen sich als geliebt erfahren haben. Menschen, deren Mütter und Väter Leid erfahren haben in den Wirren des Krieges, die womöglich sogar selbst zum Leid anderer beigetragen haben, entzündeten ein Licht des Friedens. Sie haben in der Vergangenheit verschiedenen weltlichen Herren gedient, die eine Einheit durch Krieg, Tod und Eliminierung einzelner oder ganzer Glaubensgemeinschaften erreichen wollten.
Aus dieser Erfahrung heraus aber haben sie sich neu besonnen darauf, dass der, der nur lieben kann, nicht gesondert, geschweige denn ausgesondert liebt, sondern universell, ganz und alle; sie haben sich erinnert an den, der niemals ausgrenzt und eliminiert, sondern seine Arme zur Umarmung so weit ausstreckt, dass alle darin Schutz erfahren können. Dieses Altenberger Licht und die Menschen, die es hüten und weitertragen, sie sind Menschen, die mit beiden Beinen auf der Erde stehen, die um die Wirklichkeiten des Lebens wissen und ihnen nicht ausweichen und zugleich sind sie Menschen, die Zeichen zu setzen wissen, Zeichen der Zuversicht und der Hoffnung, dass das Verbindende zwischen den Menschen mehr wiegt als das Trennende und dass das Mühen, das Gemeinsame zu suchen immer lohnenswert ist. Am kommenden Samstag, dem 1. Mai, wird es wieder entzündet.