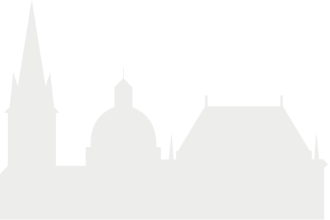Meine Ostermorgengedanken
Ich bekomme die Schlussszene des vergangenen Sonntagskrimis nicht aus meinem Kopf heraus: Dieses erbärmliche Quieken der Schweine. Ich weiß nicht, wer den Polizeiruf am vergangenen Sonntag auch gesehen hat. Die Tiere eines Bauernhofes mussten gekeult werden, weil die Schweinepest in der Gegend wütete. Männer in weißen Schutzanzügen und den entsprechenden Todeswerkzeugen marschierten in Richtung des Schweinestalls und noch bevor sie das Tor öffneten, schrien die Schweine, als ob sie schon ahnten, dass ihnen der sichere Tod bevorstehe. Diese Todesschreie der Ausweglosigkeit liegen mir bis heute in den Ohren. Natürlich weiß ich um die Fiktion dieses Krimis und natürlich weiß ich, dass den Tieren kein Leid zugefügt wurde. Aber dieser Schrei der Tiere, der aus dem Off aus dem Schweinestall in mein Wohnzimmer drang, der machte mir deutlich, wie groß die Angst vor dem Tod ist, bei Tieren nicht minder wie bei Menschen.
Zuvor in den Nachrichten wurden Bilder aus dem Gazastreifen gezeigt; Kinder, die um ihr Leben bangen und in ihren Augen sah ich den gleichen stummen Schrei. Die Angst war gleichsam greifbar; die Angst vor dem Sterben.
Vor einigen Wochen, als ich meinen Geburtstag gefeiert habe, da wurde mir bewusst, dass ich jetzt das Alter erreicht habe, in dem mein Vater vor 38 Jahren gestorben ist. In dieser Nacht, als alle meine lieben Gäste wieder heimgefahren sind und ich im Bett lag, da wurde mir schlagartig bewusst, dass sich auch mein Leben dem Ende nähert.
Tod ist unausweichlich. Ich kann mich heute damit trösten, dass es mir gut geht. Ich kann mir den Spruch von Snoopy zusprechen, der, als er mit einer Freundin am Seeufer stand und sinnierte, dass er eines Tages tot sein werden, von seiner Freundin korrigiert wurde. Sie antwortete nämlich: „Aber jeden Tag bis dahin darfst du leben“.
Dankbar zu sein und zu bleiben dafür, dass ich, dass wir heute leben können und leben dürfen, sicherer, behüteter, auch geliebter als manch andere und manch anderer auf dieser Erde: Diese Dankbarkeit sollten wir uns bewahren.
Trotz alledem bleibt die Gewissheit: Am Ende steht der Tod und dem kann keine und keiner entfliehen.
Um diese unumkehrbare Wirklichkeit wissend, feiern wir heute Ostern. Ostern: Das Lebensfest. Maria von Magdala wollte dem Tod ihren Respekt erweisen und ging zum Grab, so wie viele von uns zu den Gräbern ihrer Lieben gehen, um sich ihrer zu erinnern. Aber der Stein war weggewälzt und das Grab war leer. Was ist das für eine Geschichte?
Am vergangenen Dienstag, nach dem Marktzeitgottesdienst vertraute mir eine Besucherin an, dass es ihr immer schwerer falle, an so etwas wie Auferstehung glauben zu können. „Das ist einfach unvorstellbar“, so meinte sie.
Ich habe ihr da beigepflichtet; ich kann mir das auch nicht vorstellen: Auferstehung, ein Leben nach dem Tod. Ob sich Maria von Magdala das vorstellen konnte? Wohl auch nicht. Sie dachte, man hätte den Leichnam gestohlen. Den Jüngern, denen sie kopfschüttelnd davon erzählte, denen erging es nicht anders. Auferstehung kann man sich nicht vorstellen.
Ich bin nicht der große Friedhofsbesucher, ich gestehe es. Aber ab und zu bittet mich meine Mutter, nach Vaters Grab zu schauen; die Erde etwas aufzuharken, das Rosenbäumchen zu gießen, oder ein paar Stiefmütterchen neu einzupflanzen. Wenn ich dann am Grab stehe, dann werden Erinnerungen wach; oder besser: Erinnerungen werden lebendig.
Vielleicht erging es Maria von Magdala ähnlich. Und diese Erinnerungen hat sie dann mit ihren Freundinnen und Freunden geteilt. Sie hat davon erzählt. Erzählen bewirkt Wunderbares; im Erzählen wird lebendig, was den Sinnen entzogen ist; im Erzählen wird spürbar, dass nahe ist, was einem genommen wurde; im Erzählen geschieht Auferstehung. Im Erzählen können Dornenkronen brechen, wie wir auf unserer neuen Osterkerze zeigen, und Menschen können das Tanzen neu lernen.
Ostern ist ein Erzählfest; und es ist ein Hoffnungsfest. Wenn wir von unserem Leben erzählen, von unseren Ängsten ebenso wie von unseren Sehnsüchten: Ja, daraus kann neues Leben auferstehen.