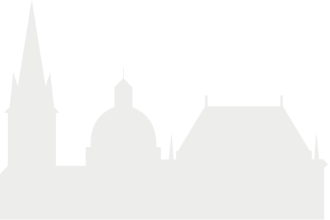Warum es nicht schlimm ist, dass Maria keine Jungfrau war und Jesus nicht in Betlehem geboren wurde
"Und sie gebar ihren Sohn, ihren Erstgeborenen.“
So erzählt es Lukas in seiner Geburts- und Kindheitsgeschichte, mit der er Jesus als den erwarteten Retter in den Tradition der Hebräischen Bibel verankert. Er erzählt eine Geschichte mit dem Vokabular seiner Zeit, in der Geburtsverheißungen, Jungfrauengeburten und Gotteskinder zum kulturellen Bilderbestand gehörten so wie heute Feenglitzer und Einhörner, die Postkartenständer bevölkern und die es also in einer gewissen Weise „gibt“, obwohl allen klar ist, dass sie kein Teil der physischen Welt sind. Es ist nicht wichtig, ob Maria „wirklich“ Jungfrau war – Jungfräulichkeit ist ohnehin ein ausschließlich kulturelles Konstrukt, denn am Hymen eines weiblichen Menschen kann man nicht sehen, was dieser Mensch sexuell schon erlebt hat. Die Autor*innen der biblischen Schriften erzählen Geschichten davon, wie alles angefangen hat, wie es wurde, was es war, was das auf Gott hin bedeutet und was noch zu hoffen ist. Wir stellen biblischen Texten oft die Frage „Ist das wahr?“ und meinen damit, ob es „in echt“ so passiert sei. Aber wenn es nur um Fakten ginge, dann wäre es banal. Die Faktifizierung tut dem Glauben nicht gut; umso weniger, wenn auch noch biologisch Unmögliches zum Faktum gemacht wird wie die Geburt „aus der Jungfrau“ – was nicht nur nebenbei eine höchst frauenfeindliche Formulierung ist. Es geht um mehr als um Fakten, es geht um die Bedeutung, denn erst aus den Deutungen können wir leben.
Die biblischen Autor*innen erzählen solche Geschichten über Jesus, den Menschen, in dessen Leben ihnen Gottes Gegenwart aufgeschienen war. Sie erzählen solche Geschichten in einem kulturellen und religiösen Umfeld, in dem allen völlig klar war, dass er ein Mensch unter Menschen gewesen war. Wesentlich schwieriger war es, ins Wort zu bringen, dass er auch Gott unter Menschen gewesen war. Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott – man wusste, dass man wirklich große Worte wählen musste, und bewegte sich doch in einem sprachlichen Bereich, der näher an der Poesie als an der Philosophie ist, denn es gibt Dinge, die kann nur ein Gedicht erschließen.
Wir heute haben ein umgekehrtes Verständnisproblem. Wir haben die Göttlichkeit Jesu so verinnerlicht, dass es uns kaum noch greifbar ist, dass er wirklich ganz und gar Mensch war. Einer wie wir – einer, der Hunger kannte, Durst, schlechte Laune am Morgen, sexuelle Bedürfnisse, Freundschaften, die nicht immer einfach sind, Familie, die auch nicht immer einfach ist, einen Glauben, der erst wachsen muss. Uns scheint das kaum möglich, und es fällt uns schwer, die Geschichten von Jesu Geburt nurmehr als Lebensdeutungen zu lesen, als Geschichten, die vom Ende her erzählt wurden, das ein neuer Anfang geworden war. Schon Karl Rahner beobachtete, dass unser Jesusbild eine deutliche Schlagseite hin zur Göttlichkeit hat und wir sein Menschsein darüber nicht mehr recht wahrnehmen. Die dominierende Vorstellung, die auch kirchenpolitisch verzweckt wird, setzt voraus, dass Gott irgendwie den Embryo in Marias Gebärmutter auf eine besondere Weise bewohnt habe – als sei er eine Art Alien, als habe Gott sich auf die Erde gebeamt und als sei allen von Anfang an klar gewesen, dass dieses Menschenkind Gott war - als sei hier ein anderes Wunder geschehen als bei jeder Geburt. In vielen Formulierungen auf Weihnachtsgrüßen bleibt mindestens unklar, ob die Schreibenden Sätze wie „Gott wird Mensch“ oder „Gott kommt auf die Erde“ noch als Bild verstehen. Heute gibt es auch kaum noch das Gegengewicht einer säkularen Öffentlichkeit, die sich für das Leben Jesu als „echten Menschen“ interessiert und Bücher liest wie „Verschlusssache Jesus“ (auch wenn das in weiten Teilen von der Schwierigkeit handelt, ohne Zugehörigkeit zu einer Jerusalemer Studien-Institution Zutritt zur Bibliothek der Ecole biblique zu erhalten).
Wenn es aber nicht gelingt, Jesus ganz wirklich als Menschen wahrzunehmen, ergibt sich dann die Vorstellung, dass Gott sich einen Männerkörper zur Materialisierung ausgesucht hätte. Dass „Sohn“ vor allem „Nicht-Tochter“ bedeute, kam als Vorstellung erst auf, als im Zug der Aufklärung ein Konzept von Geschlecht entwickelt wurde, das zwei einander polar entgegengesetzte Sorten Menschen kennt, die nicht im wesentlichen gleich, sondern verschieden seien. Damit wird noch einmal der Blick darauf frei, dass es jede Menge Zeitgeist in der Kirche gibt, nur eben – noch – nicht von heute. Es geht ja aber nicht darum, als wer Gott sich offenbaren wollte, schon gar nicht, ob Gott männlich oder weiblich Mensch werden wollte, als wäre Gott ein Akteur wie Zeus, der mit Gestaltwechseln in die menschliche Geschichten eintritt. Es geht wie bei allen biblischen Geschichten darum, in wem Menschen Gott erkennen können.
Menschen haben Gottes Wirklichkeit und Verheißung in Kontakt mit Jesus erfahren, der ein Leben voller Offenheit und Zugewandtheit geführt hatte und der ihnen die Gegenwart durchsichtig machen konnte auf Gott hin. An ihm und in Beziehung zu ihm konnten Menschen Gotteserfahrungen machen: die Erfahrung, satt zu werden, die Erfahrung, dass es genug für alle gibt, die Erfahrung, heil zu werden, die Erfahrung, Schuld hinter sich lassen zu können, schließlich die Erfahrung, dass die tödliche Gewalt nicht das letzte Wort hat. Diese Erfahrungen der Begegnung mit einer Wirklichkeit, die größer, weiter und tiefer ist als unser Leben zwischen Aufgang und Untergang, bedeuteten ihnen: Mehr geht nicht, wir sind Gott selbst begegnet.
Darum erzählten sie Geschichten davon, dass Jesu Leben von Anfang an unter der Verheißung des Engels gestanden hatte: Siehe, ich verkünde euch eine große Freude. In diesem Licht gesehen, sind die Erzählungen im Lukas- und im Matthäusevangelium relativ zurückhaltend ausgefallen. Vielleicht haben Menschen sie deswegen später nicht mehr als Geschichten erkannt. Indem dann aber die Göttlichkeit wörtlich, fleischlich genommen wird, verlagert sich der Ort der Gegenwart Gottes auf diese Auswahl und Göttlichkeit des entstehenden Lebens von allem Anfang an. Damit verlieren die Erfahrungen mit Jesus, von dessen Stimme gerufen die an Leib und Seele Gelähmten mühelos aufstehen konnten, an Gewicht. Denn nicht mehr die Handlungen, Haltungen und Hoffnungen Jesu sind dann erster Ort der Selbstmitteilung Gottes, sondern sein Geborensein und Gestorbensein. Und so hat es Eingang gefunden in unser Glaubensbekenntnis: Empfangen, geboren, gelitten, gestorben, begraben, auferstanden. Das Dazwischen fehlt, und damit fehlen genau die Erfahrungen, aus denen heraus Menschen Jesus als Mensch-von-Gott und Mensch-auf-Gott-hin erlebt hatten – unter anderem deswegen konnte sich dann auch eine Gottesvorstellung durchsetzen, die das Opfer des Sohnes forderte. Wir brauchen aber gerade den Bezug auf die Erfahrungen des Heilwerdens, damit die Geschichte von Jesu Geburt für uns jenseits dieses toxischen Gottesbildes noch Bedeutung haben kann: Bedeutung für unser Heute, in dem Gott gegenwärtig ist.