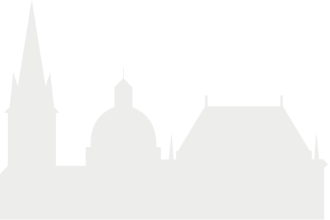ERDÖL IM GARTEN
Folge 29 des Blogs "WELTEN - SPRÜNGE. Eifel, Amazonas und zurück" von Friederike Peters
In einem Osterrundbrief aus Ecuador bat ich vor einigen Jahren meine LeserInnen, sich einmal vorzustellen, sie bekämen von der Behörde die Nachricht, in ihrem Vorgarten unter den Narzissen sei Erdöl gefunden worden, an der Straßenkreuzung würde im Sommer ein Bohrturm aufgestellt und alle Stadtteilbewohner seien zu einer Infoveranstaltung in der nächsten Woche eingeladen.
Wütend oder hoffnungsvoll gehen alle hin, um dort zu hören, dass sie als Anwohner natürlich entschädigt werden. Sie sollen eine Liste der bei den Baumaßnahmen zerstörten Narzissenzwiebeln und anderer Vorgartenblumen einreichen, die selbstverständlich genauestens bewertet und bezahlt würden. Im Übrigen sei dies ein großartiges Projekt, für das Deutschland jedem von ihnen persönlich zu Dank verpflichtet sei. Als kleine Anerkennung lade man sie heute zum Essen ein und bitte alle, sich auf der Teilnahmeliste einzutragen. Guten Appetit!
Als der Bauturm mit einem großen Kranwagen angeschleppt wird, die Anwohner sich vom Schreck erholt haben und die Mehrheit lautstark auf der Straße protestiert, wird ihnen mitgeteilt, sie seien ja vorher über alle Pläne informiert worden und hätte schriftlich ihr Einverständnis zur Ölbohrung erklärt. Als sie jetzt erst recht protestieren, zeigt man ihnen ihre Unterschriften auf der Teilnahmeliste des Essens und den kleingedruckten Text der Einverständniserklärung auf eben dieser Liste. In ihrem Stadtviertel entsteht das größte Erdölabbaugebiet Deutschlands. Die Narzissenzwiebeln werden ihnen natürlich auf Heller und Pfennig erstattet.
So geschehen nicht in der Eifel, aber seit Jahren in den Gärten und auf dem Gemeinschaftsland vieler meiner FreundInnen und Bekannten am Napofluss.
Was für einen Roman zu unglaubwürdig klingen würde, ist in Wirklichkeit gerade krass genug. Aber es kam noch härter - - -
Am 7. April letzten Jahres brachen an einem Tag die beiden großen Ölpipelines des Landes, die das Rohöl an die Küste transportieren. Innerhalb von zwei Tagen flossen 20.000 Fass Rohöl in den Coca- und Napofluss und überschwemmten das Gartenland am Ufer von mindestens 127 Naporunagemeinden. Aus dem Boden einiger dieser Gemeinden war es vorher abgepumpt worden. Jetzt lag es über den Maniokfeldern, unter den Bananensträuchern, auf den Pfaden am Flussufer, auf denen man barfuß zum Fischen geht, auf den Körpern der Fische, die man zum Essen braucht, an den Badestellen der Menschen, an den Bächen, wo viele Menschen ihr Trinkwasser abschöpfen müssen aus Mangel an Trinkwasserleitungen. Es lag, bis es in den Boden gesickert war oder der Fluss es weiter in den nächsten Garten getragen hatte.
Auch heute, nach einem Jahr, ist es im Boden und im Wasser nachweisbar.
Am 7. April diesen Jahres standen die Naporuna wieder vor dem Gerichtsgebäude in der Provinzhauptstadt Coca zum Protest. Im Laufe des Jahres haben sie den Staat auf Säuberung und Entschädigung verklagt: "Anklage aus Mangel an Beweisen abgelehnt!" Da das Urteil nach wie vor nicht schriftlich ausgehändigt wurde, kann der Prozess nicht in die 2. Instanz gehen. Ende März wurden stattdessen die Menschenrechtsanwälte, die die Naporuna in diesem Prozess vertreten, und der Vorsitzende der Naporunaorganisation wegen "Aufhetzung" der Leute angeklagt. Die Anwälte wurden genau für den 7. April diesen Jahres zur Anhörung vorgeladen. 500 Naporuna begleiteten sie. Der Richter des ersten Prozesses, der in diesem Fall als Ankläger auftrat, ließ sie zu gegebener Zeit wissen, dass er in der Mittagspause sei. Die Anhörung fand nicht statt, wohl aber am 8. April die Anhörung des Vorsitzenden der Naporunaorganisation. Konsequenzen und weiteres Vorgehen des Gerichtes bleiben unklar. Die Betroffenen bleiben bis auf Weiteres Angeklagte in einem laufenden Prozess.
Und in meinem Vorgarten blühen die Narzissen.